Noch vor wenigen Jahren sprach man kaum offen über Themen wie Kartenlegen oder Energiearbeit, ohne belächelt zu werden. Esoterik fand meist im privaten Rahmen statt und hatte in der breiten Öffentlichkeit weder Präsenz noch Anerkennung. Das hat sich deutlich verändert.
Heute begegnet uns Esoterik regelmäßig – in Fernsehsendungen, Podcasts und auf Social Media. Meist verpackt in ein positiv besetztes, spirituelles Gewand, das Heilung, Selbsterkenntnis und Lebenshilfe verspricht. Dass dieser Bereich weitgehend unreguliert ist, wird selten thematisiert. Auch mögliche Risiken, zum Beispiel wenn solche Angebote professionelle Hilfe ersetzen sollen, bleiben meist unerwähnt.
Ein aktuelles Beispiel ist die ZDF-Reihe 37 Grad Leben mit der dreiteiligen Serie „Suche nach dem Spirit“. Gezeigt werden Menschen, die aus persönlichen Krisen herausfinden wollen, z. B. durch schamanische Rituale, Tarotkarten oder, formal nicht zur Spiritualität gehörend, Life-Coaching. Was an den drei Sendungen und den begleitenden Social-Media-Posts problematisch ist, fasse ich im Folgenden zusammen:
Folge 1: Schamanismus
Inhalt: Zwei Frauen wenden sich dem modernen Schamanismus zu, eine davon praktiziert selbst. Gezeigt werden Rituale wie das Reinpusten in Steine via Laptop, das Arbeiten mit „Energieportalen“ (z. B. Bäumen) und das Werfen von Steinen zur Deutung des energetischen Zustands. Die Inszenierung ist stark emotionalisiert mit Rauch, Trommeln, Sonnenuntergang, Meer und melancholischer Musik. Vermittelt wird hier der Eindruck einer persönlichen, heilsamen Praxis.
Einordnung: Der Psychologe Leon Windscheid warnt zwar vor Schamanismus, doch eine klare Einordnung als Teil moderner Esoterik fehlt. Begriffe wie „magisches Denken“, „kommerzialisierte Spiritualität“ oder „esoterische Heilversprechen“ werden nicht genannt. Auch kulturelle Aneignung, etwa durch die Nutzung indigener Symbole und Rituale, bleibt unerwähnt.

Was fehlt: Eine fachliche Einordnung durch Expert:innen für Esoterik, religiöse Praktiken oder kulturelle Aneignung. Stattdessen erfolgt ausschließlich eine psychologische Betrachtung mit Hinweisen auf Wohlbefinden oder Placebo-Effekte. Offene Fragen bleiben: Woher stammen diese Rituale? Wer darf sie ausüben? Was bedeutet es, wenn indigene Traditionen hierzulande als persönliche Heilmethode vermarktet werden? Ohne diesen Kontext erscheint Schamanismus als unproblematische spirituelle Alltagspraxis.
Folge 2: Life-Coaching
Inhalt: Im Mittelpunkt steht Life-Coaching, eine Form der Beratung, die an sich nichts mit Spiritualität zu tun hat, aber in der Serie dennoch als Teil spiritueller Sinnsuche dargestellt wird. Leon Windscheid weist auf Risiken hin: fehlende Standards, überzogene Heilsversprechen und potenziell schädliche Abhängigkeiten.
Einordnung: Unklar bleibt, warum Coaching in einer Serie über „Spiritualität“ behandelt wird. Die Folge vermittelt, Coaching sei Teil einer spirituellen Sinnsuche, obwohl es in den meisten Fällen nichts mit Spiritualität zu tun hat.
Was fehlt: Eine klare Abgrenzung zwischen Coaching und spirituellen Praktiken. Die Gleichsetzung beider Bereiche findet sich auch in den begleitenden Social-Media-Beiträgen wieder (siehe unten).
Folge 3: Tarot
Inhalt: Gezeigt werden zwei Frauen – eine bietet Tarot professionell an, die andere nutzt es für persönliche Fragen. Die Karten dienen laut Sendung als Spiegel der eigenen Themen. Es geht um Einsamkeit, Orientierung und das Bedürfnis nach Verbindung.
Einordnung: Leon Windscheid spricht über mögliche Gefahren: Abhängigkeit, Ausnutzung in Krisen, fehlende Regulation. Er betont, dass psychisches Leid professionelle Hilfe braucht und Kartenlegen das nicht ersetzen kann.
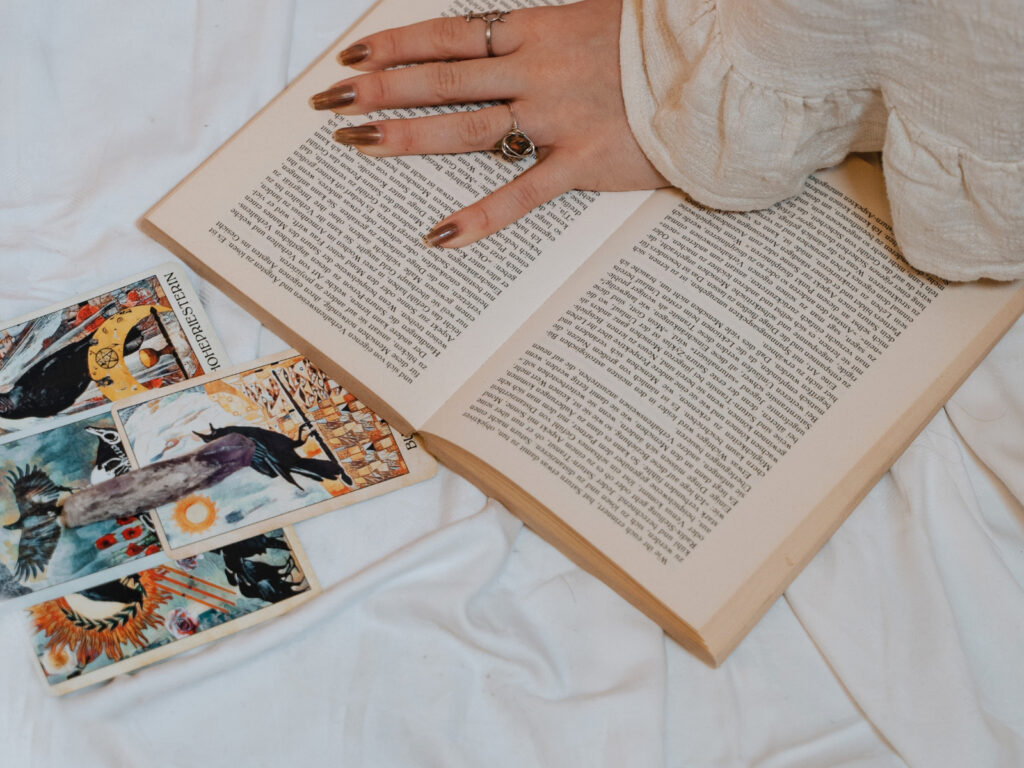
Was fehlt: Die Sendung liefert keine kritische Einordnung der esoterischen Praxis. Es wird nicht erklärt, wie Tarot tatsächlich wirkt oder welche psychologischen Mechanismen langfristig greifen. Risiken wie magisches Denken, emotionale Abhängigkeit oder das Auslagern oder Verändern eigener Entscheidungen bleiben unerwähnt. Dass Tarot der Einstieg in eine magische Weltsicht sein kann bis hin zu Verschwörungsdenken wird nicht angesprochen. Stattdessen entsteht der Eindruck, Tarot sei eine Methode der Selbstreflexion, solange keine psychische Erkrankung vorliegt. Auch hier fehlt die Perspektive von Expert:innen für Esoterik, die über Wirkmechanismen, Dynamiken und Risiken hätten aufklären können.
Sechs Frauen auf der Suche – ein Mann erklärt’s
In allen drei Folgen stehen ausschließlich Frauen im Mittelpunkt: als Suchende, Praktizierende oder Anbieterinnen beratender oder esoterischer Dienste. Die Einordnung übernimmt ein Psychologe. Ihm ist kein Vorwurf zu machen, doch dass hier ausgerechnet ein Mann ausgewählt wurde, um weiblich erzählte Sinn- und Krisengeschichten einzuordnen, wirkt zumindest befremdlich. Ein Muster, das sich auch heute immer noch in vielen medialen Formaten wiederfindet.
Ergänzend zur TV-Reihe: Der Instagram-Content
Die begleitenden Instagram-Beiträge von @zdf37grad (329.000 Follower, 9 Posts) verstärken die problematische Tendenz der TV-Folgen:
Emotionalisierung statt Einordnung
Alle sechs Frauen aus der Serie werden in kurzen Ausschnitten gezeigt, jedoch hier ohne die eigentlich wichtige Einordnung des Psychologen. Sanfte Musik und ästhetische Settings emotionalisieren die Darstellung, statt sie sachlich zu bewerten. So vermittelt jedes Reel, dass esoterische Praktiken normal und völlig okay sind – auch als Geschäftsmodell.
Vermischung von Begriffen
Tarot, Schamanismus oder Manifestation erscheinen gleichrangig neben Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Die Begriffe Spiritualität und Esoterik werden nicht erklärt oder voneinander abgegrenzt, sondern meist nur als #Hashtags verwendet.
Keine Reflexion kultureller Aneignung
Symbole und Praktiken aus indigenen und asiatischen Kulturen wie Schamanismus, Räuchern mit Mesa-Bündeln oder Traumfängern werden übernommen und gezeigt, ohne Herkunft, Bedeutung oder die Problematik der kulturellen Aneignung zu erläutern. So entsteht der Eindruck, diese Traditionen seien unproblematisch und könnten beliebig genutzt oder vermarktet werden.
Kommerzialisierung wird ausgeblendet
Die Social-Media-Beiträge thematisieren nicht, ob und in welchem Rahmen es überhaupt in Ordnung ist, mit esoterischen Praktiken, magischem Denken oder kulturell angeeigneten Traditionen Geld zu verdienen. Insbesondere wenn diese mit Heilungsversprechen oder Begleitung in persönlichen Krisen verbunden werden.
Unklare Rolle der Expertin
In nur einem Instagram-Post wird eine Expertin für Esoterik und Weltanschauungsfragen zitiert, allgemein zu problematischen Strukturen wie Machtmissbrauch oder Abhängigkeiten. Meditation, Astrologie, Schamanismus und Life-Coaching werden dabei ohne klare Abgrenzung vermischt, was den Eindruck erweckt, alle Praktiken gehörten gleichermaßen zur Spiritualität.
Fazit: Wenn Medien Esoterik normalisieren
Die ZDF-Reihe 37 Grad Leben „Auf der Suche nach dem Spirit“ zeigt eine Mischung aus moderner Esoterik, Coaching und Selbsthilfepraktiken. Was fehlt, ist Ausgewogenheit: Es kommen weder Menschen zu Wort, die negative Erfahrungen gemacht haben, noch unabhängige Expert:innen für Esoterik und Pseudowissenschaft, die über Abhängigkeiten und kommerzielle Interessen aufklären.
Nicht weniger problematisch ist, dass Spiritualität, Esoterik und Coaching vermischt und mit Psychologie als Lebenshilfe gleichgesetzt werden. Für Zuschauer:innen wird es dadurch nahezu unmöglich, zwischen persönlichen Erfahrungen und fragwürdigen Methoden zu unterscheiden. Aspekte wie kulturelle Aneignung bleiben unerwähnt, obwohl entsprechende Symbole und Praktiken aus indigenen oder asiatischen Traditionen präsent sind. Herkunft, Bedeutung und Kontext werden nicht benannt. Das trägt zur Verharmlosung, Etablierung und Entpolitisierung bei.
Am auffälligsten ist jedoch: Echte Spiritualität kommt überhaupt nicht vor!
Statt Inhalten zu spirituellen Werten, philosophischer Tiefe oder religiösen Traditionen werden fast ausschließlich lösungsorientierte, kommerzielle Konzepte präsentiert, die Frauen Geld kosten, möglicherweise in Abhängigkeiten führen und diffus als „Spiritualität“ etikettiert werden.
Von öffentlich-rechtlichen Inhalten mit großer Reichweite muss erwartet werden können, dass persönliche Geschichten nicht die einzige Perspektive bleiben, sondern durch sachkundige Einschätzungen und gegensätzliche Erfahrungsberichte ergänzt werden. Wer Formate in dieser Form inszeniert, trägt dazu bei, dass esoterische Angebote als unbedenklich und gesellschaftlich legitim erscheinen und potenzielle Risiken oder problematische Hintergründe nicht offengelegt werden.
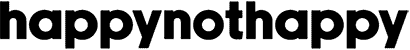











Schreibe einen Kommentar